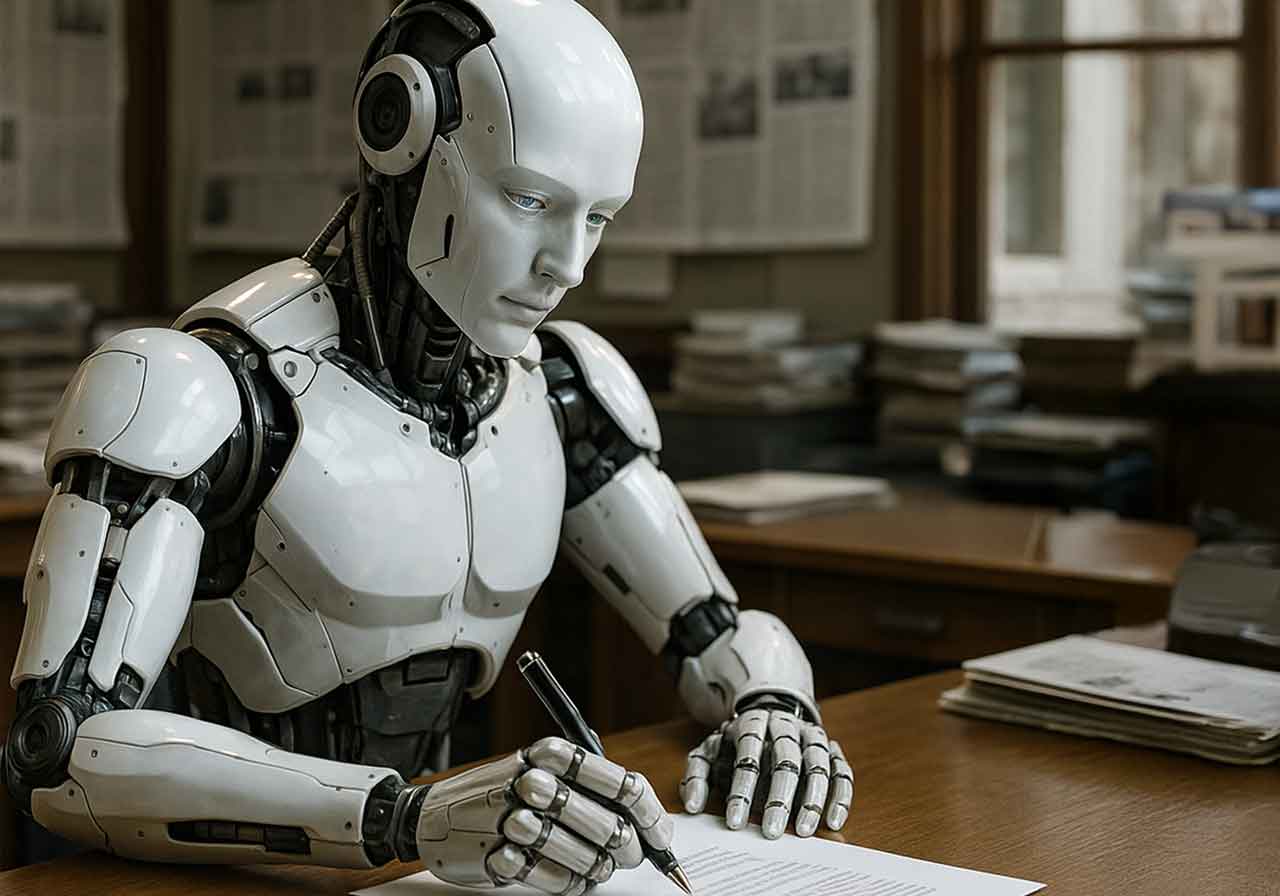Mensch und KI in der Kommunikation: Partnerschaft mit Kennzeichnungspflicht
Ab dem 2. August 2026 tritt die Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte gemäß der EU-Verordnung 2024/1689 (AI Act) in Kraft. Texte, Bilder, Videos und Audioinhalte, die vollständig oder teilweise durch KI erstellt wurden, müssen dann entsprechend gekennzeichnet werden. Doch was bedeutet „teilweise“? Und wie lässt sich eine echte Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine gestalten, ohne die kreative Eigenleistung zu verlieren?
Kreativität bleibt menschlich
Die Sorge, dass KI die menschliche Kreativität verdrängen könnte, ist unbegründet – solange wir selbst die Kontrolle behalten. Ideen, Konzepte, Strategien und Texte entstehen nach wie vor aus dem Kopf und der Hand des Menschen. Diese originäre Leistung ist nicht nur schützenswert, sondern auch unverzichtbar. KI kann dabei unterstützen, aber nicht ersetzen. Sie ist Werkzeug, nicht Urheber.
Die Rolle der KI: Ergänzen, nicht dominieren
Warum nicht die KI einfach mal „drüberschauen“ lassen? Ein Text, der bereits steht, kann durch KI mit neuen Gedanken oder besseren Formulierungen angereichert werden. Das Ergebnis ist ein Zusammenspiel – eine Interaktion, bei der der Mensch den Ton angibt und die KI Impulse liefert. Doch nicht alles, was KI vorschlägt, muss übernommen werden. Die finale Entscheidung liegt beim Menschen.
Kennzeichnungspflicht: Was zählt wirklich?
Die neue EU-Verordnung verlangt eine Kennzeichnung, wenn Inhalte täuschend echt wirken oder maßgeblich durch KI erstellt wurden. Doch wo beginnt „teilweise“? Wenn ein Mitarbeitender einen Text gegenliest und kluge Ergänzungen macht – muss dann sein Name genannt werden? Wohl kaum. Ebenso sollte eine KI, die lediglich stilistische Vorschläge macht, nicht zur Kennzeichnungspflicht führen. Entscheidend ist, wer die kreative Kontrolle hatte und woher der Kerninhalt stammt.
Rechtliche Fallstricke und Urheberrecht
In Deutschland sind KI-generierte Inhalte nicht urheberrechtlich geschützt. Das bedeutet: Wer solche Texte nutzt, kann sich rechtlichen Risiken aussetzen – etwa bei Plagiatsvorwürfen oder fehlender Quellenangabe. Der Teufel liegt im Detail. Eine Kennzeichnungspflicht schützt hier nicht nur die Transparenz, sondern auch die eigene Position.
Vertrauen in die eigene Fähigkeit
KI liefert nicht immer zuverlässig. Sie kann falsche Fakten, unpassende Formulierungen oder stilistische Brüche erzeugen. Deshalb bleibt das Vertrauen in die eigene Fähigkeit essenziell. Wer KI ergänzend nutzt, bleibt der eigentliche Autor. Die Verantwortung für Inhalt und Wirkung liegt beim Menschen – und das ist gut so.
Fazit: Die Kennzeichnungspflicht ab August 2026 ist kein Hindernis, sondern eine Einladung zur bewussten Partnerschaft mit KI. Wer seine eigene Kreativität schützt und KI als Werkzeug versteht, bleibt der Gestalter der Kommunikation. Die Entscheidung, wie viel Raum KI bekommt, liegt bei uns – und damit auch die Verantwortung für Authentizität und Qualität. Der Mensch bleibt der kreative Ursprung. Die Kennzeichnungsplicht ist kein Grund zur Sorge, sondern ein Anlass zur bewussten gestaltung der Zusammenarbeit.